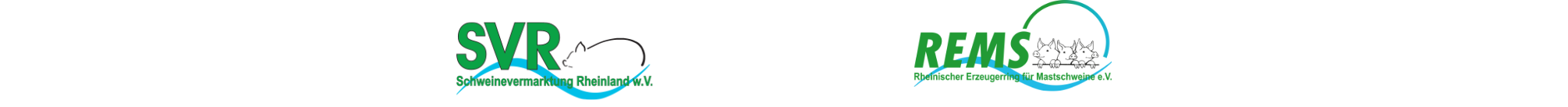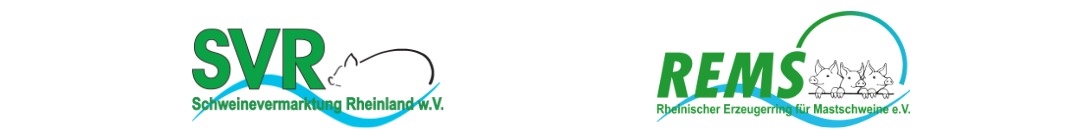Ein wenig beachtetes Urteil des Verwaltungsgerichtes in Hamburg kann auch Landswirten Chancen eröffnen, gegen ablehnende Coronabescheide vorzugehen. Darauf weist Martina Engling, Fachanwältin für Steuerrecht von der Kanzlei Geiersberger Glas & Partner mbB Rechtsanwälte in Rostock, hin.
Viele Betriebe haben in der Coronazeit Überbrückungshilfen erhalten – oft per vorläufigem Bewiligungsbescheid. Diese Bescheide waren an die Pflicht gebunden, später eine Schlussabrechnung einzureichen, erstellt durch den prüfenden Dritten (meist Steuerberater). Darin müssen die tatsächlichen Umsatzzahlen und Fixkosten angegeben werden.
Während der Prüfung kommt es nun häufig zu Rückfragen der Bewilligungsstellen – und das mit engen Fristen. “Selbst wenn diese vollständig beantwortet werden, lehnen die Behörden in einigen Fällen die Hilfe ab und fordern die gesamte Fördersume zurück”, so Engling. Begründung: Von Anfang an habe die Antragsberechtigung gefehlt, etwa weil kein ausschließlich coronabedingter Umsatzrückgang vorgelegen habe.
Der Streit darüber schwelt bereits länger. Vor allem Schweinehalter in Niedersachsen sind mit hohen Nachforderungen konfrontiert, weil die Betroffenen nach Ansicht der Bewilligungsstellen keinen ausschließlichen coronabedingten Umsatzrückgang hatten. “Unabhängig von dieser Frage, liefert das Hamburger Urteil nun etwas Schützenhilfe”, so die Anwältin.
Verhandelt wurde der Fall eines Unternehmens, das Dienstleistugen für Wegleitsysteme und Beschilderungen anbietet. Die Klägerin hatte einen vorläufigen Bescheid erhalten. Bei der Nachprüfung wurde der Bescheid mit der Begründung abgelehnt, sie sei nicht antragsberechtigt.
Die Richter urteilen: Mit dem vorläufigen Bescheid habe die Behörde entschieden, dass die Klägerin grundsätzlich antragsberechtigt sei. Die Vorläufigkeit des Bescheids bezog sich nur auf die Höhe der Förderung, nicht auf die Antragsberechtigung. “Will eine Behörde einen Bescheid rückwirkend aufheben, muss sie die Vorschriften für die Rücknahme oder den Widerruf von Verwaltungsakten einhalten – inklusive Vertrauensschutz”, betont Engling. Eine Rücknahme ist beispielsweise möglich, wenn der Antragsteller falsche oder unvollständige Angaben gemacht habe und die weiteren gesetzlichen Voraussetungen erfüllt seien. Im konkreten Fall lagen diese nicht vor, die Landwirte Umsätze und Fixkosten prognostizieren. Die Schlussabrechnung dient primär dazu, Abweichungen zu prüfen und die Höhe der Förderung zu korigieren.